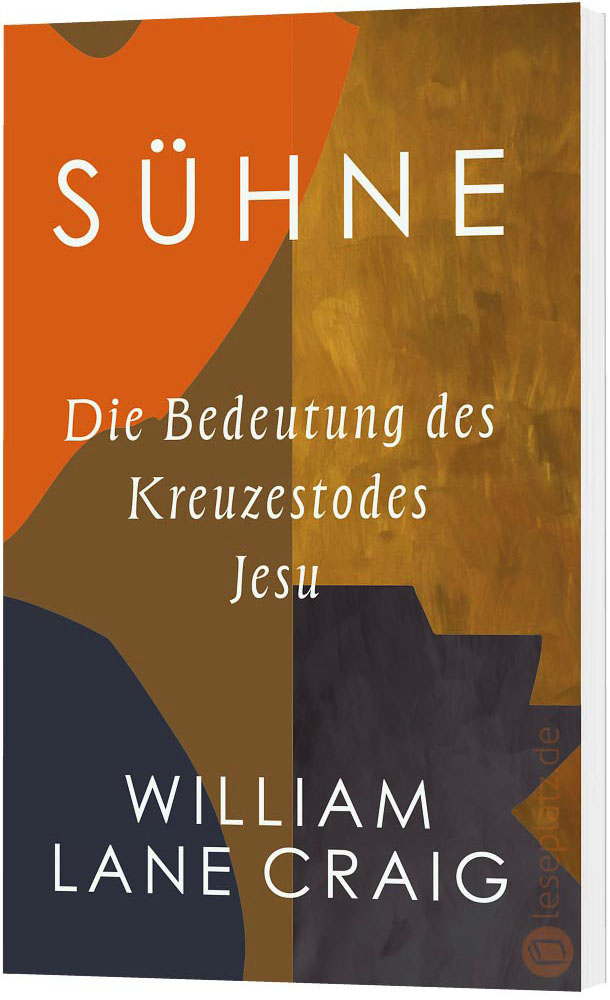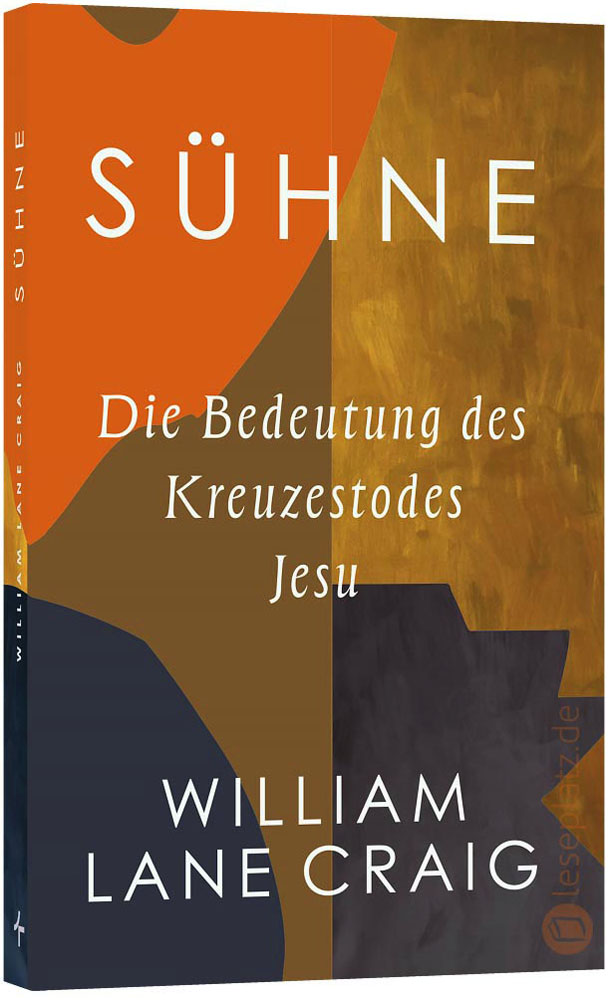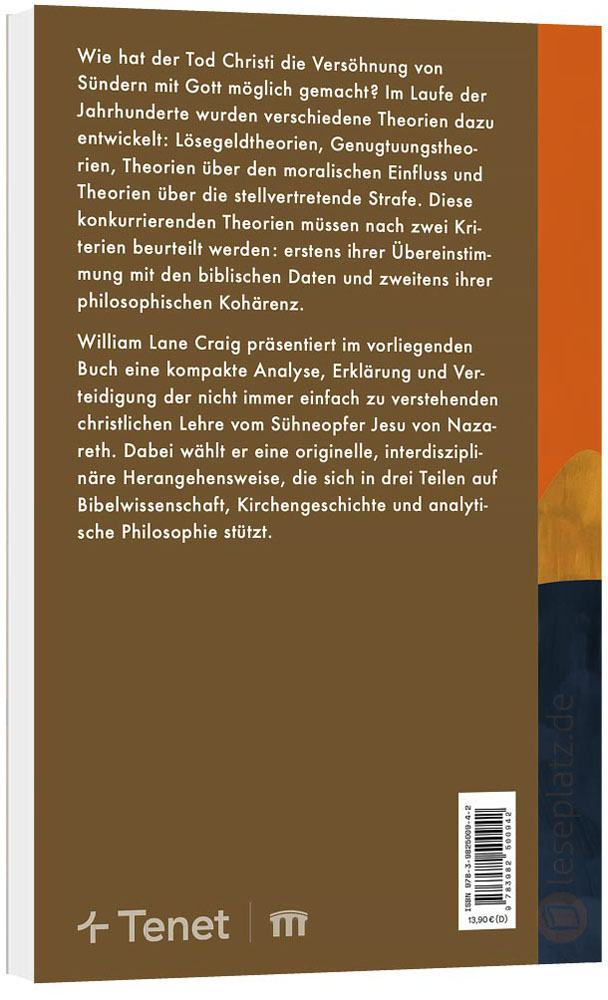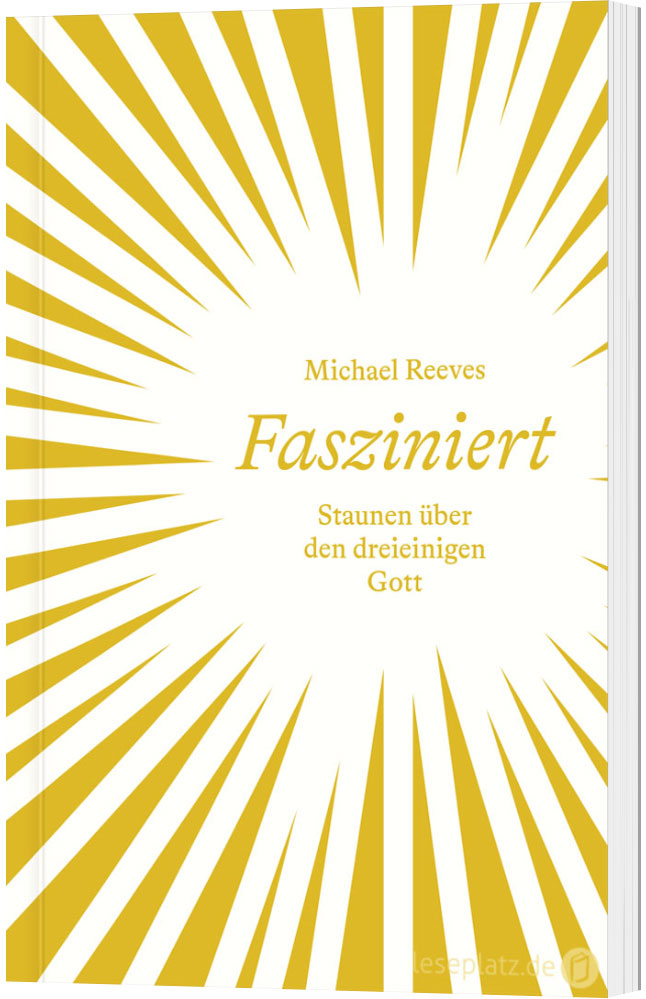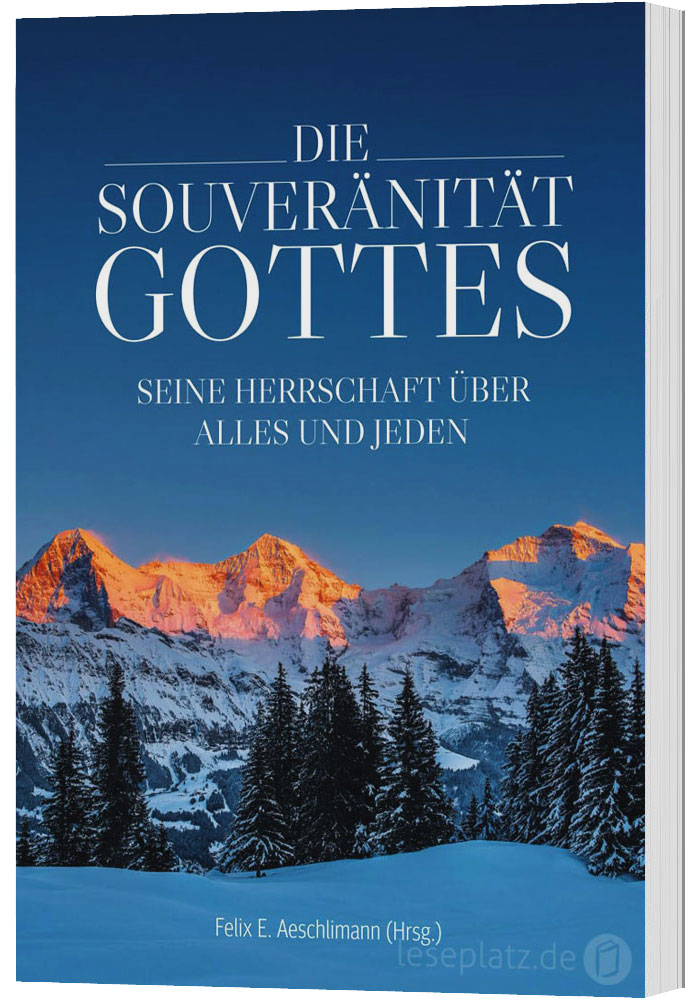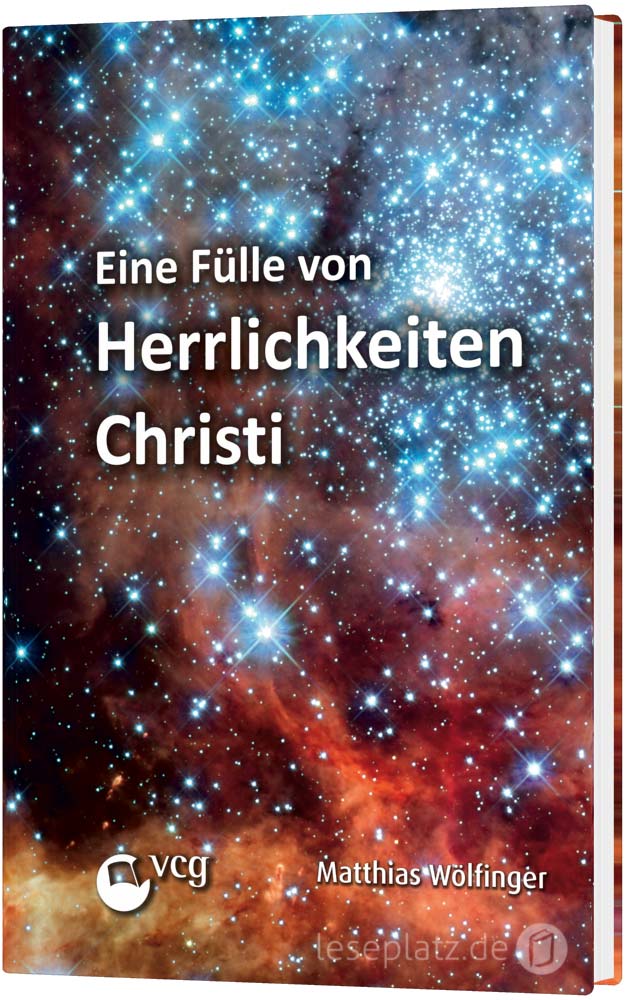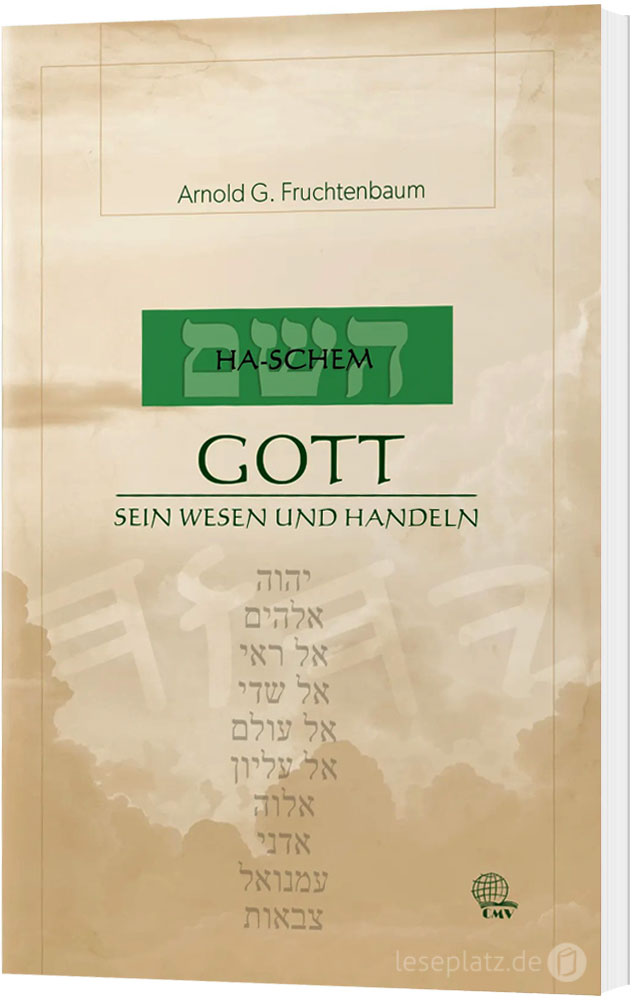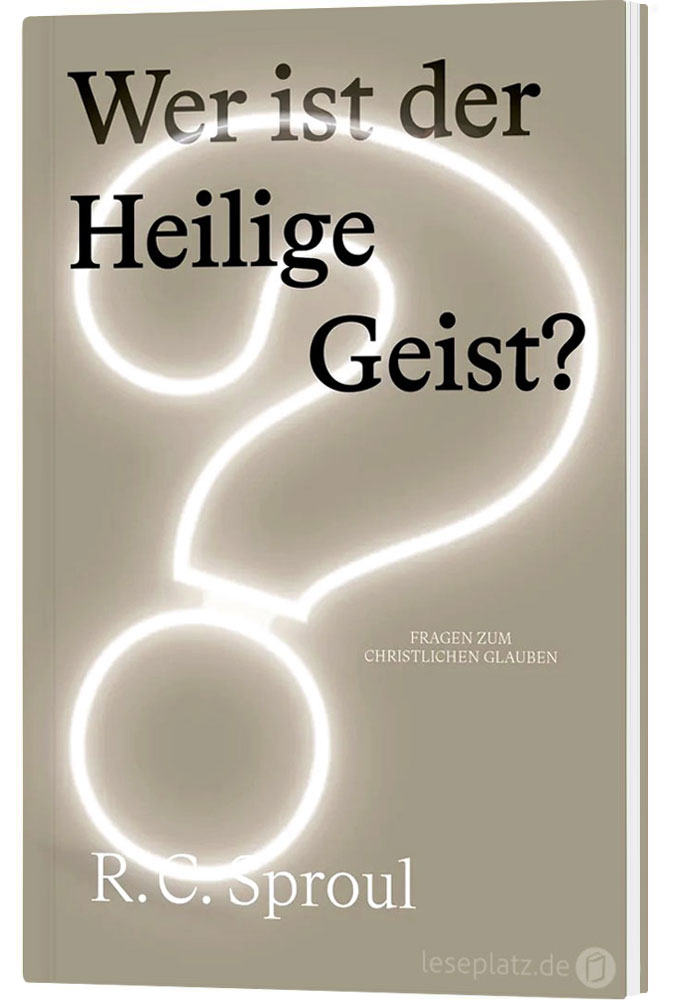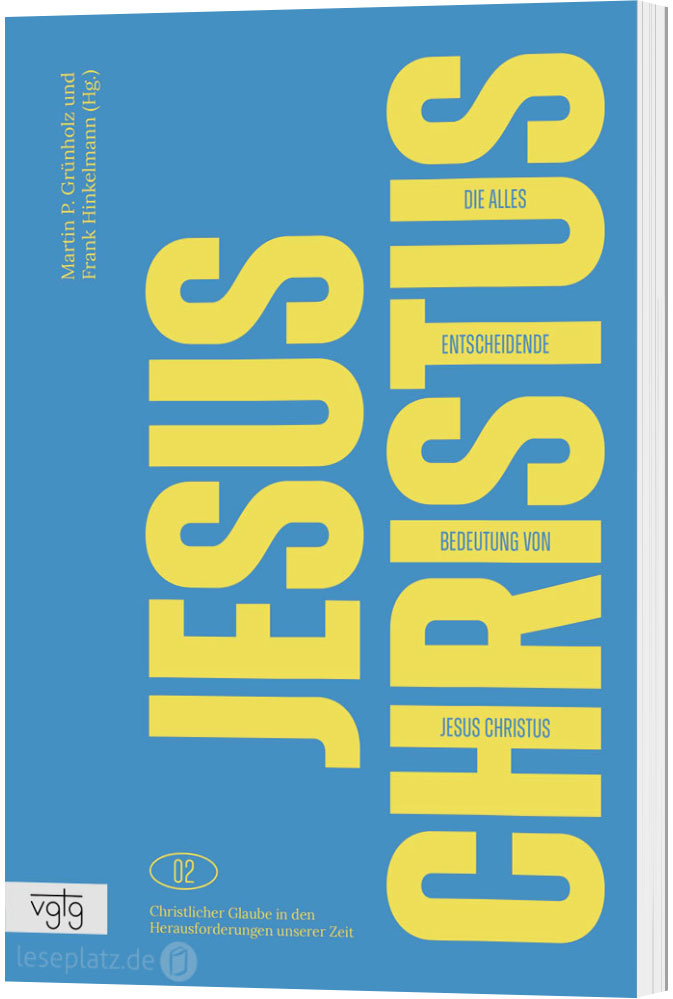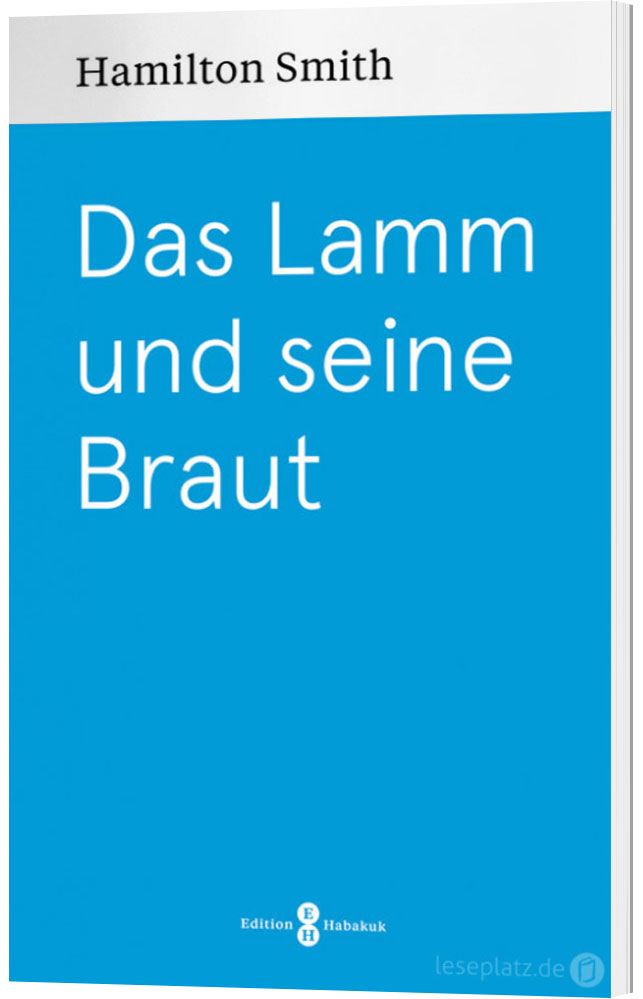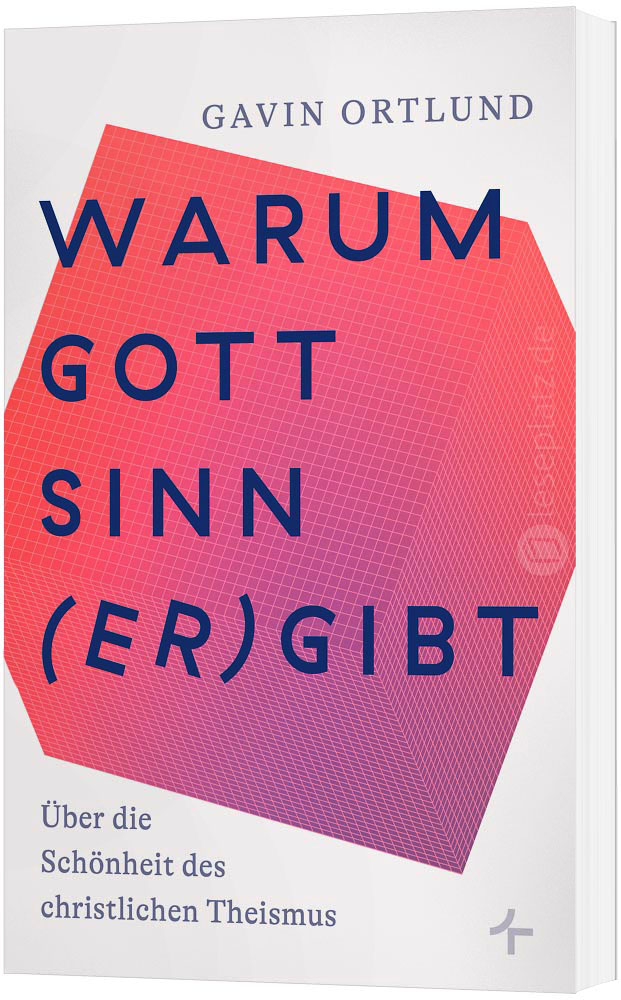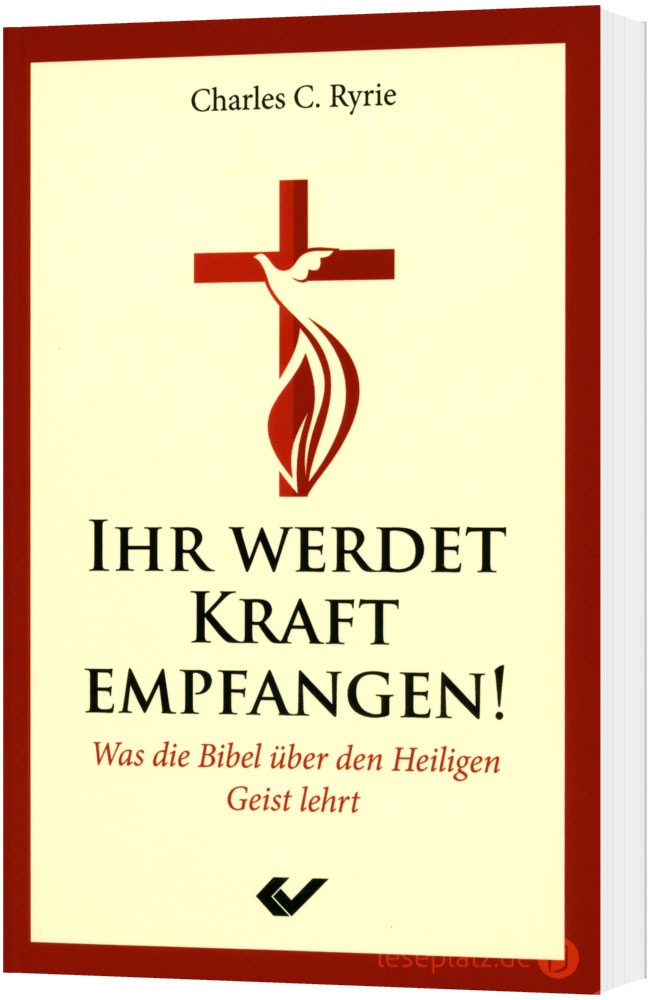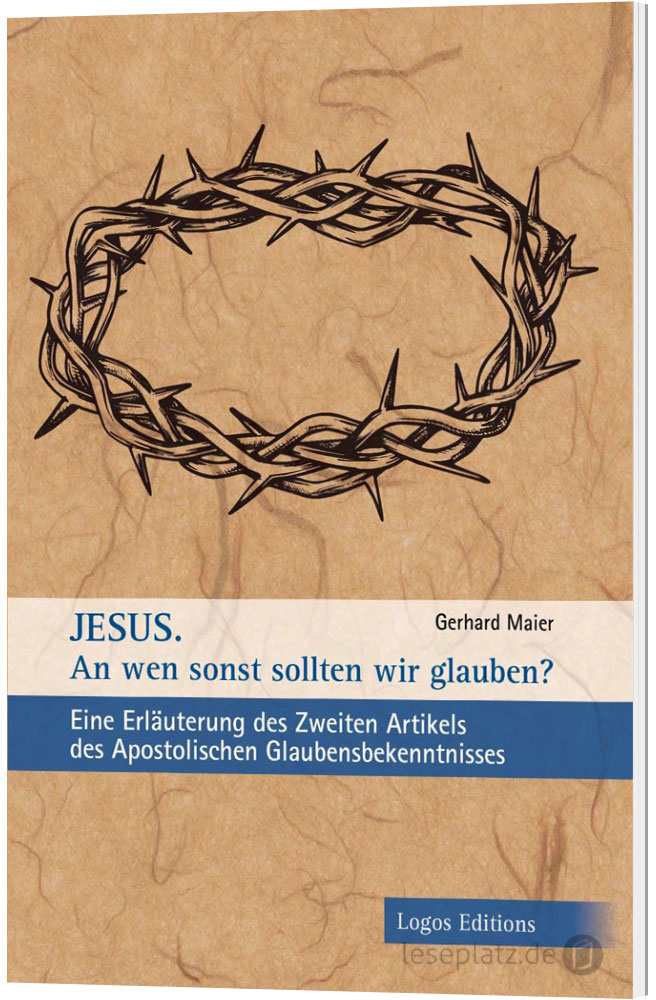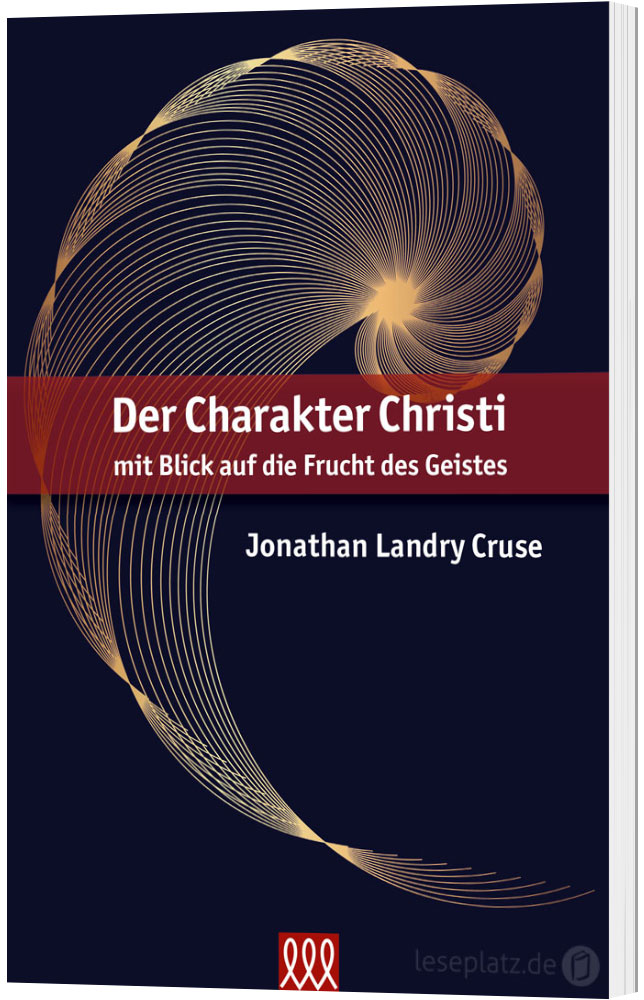Sühne
| Artikel-Nr | 253704000 |
|---|---|
| ISBN | 978-3-9825009-4-2 |
| Verlag | Tenet |
| Seiten | 142 |
| Erschienen | 14.02.2025 |
| Artikelart | Paperback, 12 x 19 cm |
William Lane Craig präsentiert in Sühne eine kompakte Analyse, Erklärung und Verteidigung der nicht immer einfach zu verstehenden christlichen Lehre vom Sühneopfer Jesu von Nazareth. Dabei wählt er eine originelle, interdisziplinäre Herangehensweise, die sich in drei Teilen auf Bibelwissenschaft, Kirchengeschichte und analytische Philosophie stützt.
| Autor: | William Lane Craig |
|---|
Anmelden
29.11.25 10:24 | Marcel
Eine fulminante Verteidigung der biblischen Sühnelehre!
Erwartungen
Ich habe mir das Buch gekauft in der Hoffnung auf Schützenhilfe im Kampf gegen die Verwässerung der biblischen Sühnelehre selbst in konservativen christlichen Kreisen; erschreckenderweise hat der Tübinger Theologe Eckstein mit seiner Existenzstellvertretung inzwischen sogar Zutritt zum Kreis der „Freien Brüder“. Das Buch hat mich nicht enttäuscht.
Inhalt
Das Buch besteht aus drei Kapiteln: Im ersten Teil untersucht Craig die biblischen Grundlagen für die Lehre vom Sühneopfer. Im zweiten Kapitel gibt er einen kirchengeschichtlichen Abriss zum Thema „Sühneopfer“. Das dritte Kapitel enthält rechtsphilosophische Überlegungen zur Plausibilität der Sühnelehre.
Craig unternimmt zunächst eine Unterscheidung zwischen Sühne als Versöhnung und Sühne als Reinigung, die ich für wenig überzeugend halte. Eine zufriedenstellende Klärung der Begriffe „Sühnung“, „Stellvertretung“ und „Versöhnung“ findet nicht statt.
Der kirchengeschichtliche Abriss hingegen ist interessant und konzise. Er stellt die Lösegeldtheorien der Kirchenväter dar – das Lösegeld wurde nach ihrer Auffassung an Satan entrichtet! –, benennt die Häresien eines Origenes und kritisiert Augustinus zurecht dafür, dass er den sühnenden Tod Jesu nicht für die einzige Möglichkeit gehalten habe, Menschen zu retten, weil er zu sehr die Rechte Satans und den Tod als Folge der Sünde statt die Gerechtigkeit Jesu fokussiert habe. Treffend würdigt er Anselm von Canterbury dafür, dass dieser den Aspekt der Wiedergutmachung in den Blick genommen habe. Er verteidigt ihn gegenüber Unterstellungen seiner Kritiker, verschweigt aber nicht, dass erst die Reformatoren den Aspekt der Bestrafung, die Strafstellvertretung und die forensische Zurechnung unserer Sünden bzw. Zurechnung der Gerechtigkeit Christi erkannt haben. Craig arbeitet die Beispiel-Theorie Abaelards heraus, betont aber, dass dies nur ein Teilaspekt seiner Sühnetheologie gewesen sei. Präzise arbeitet er die Häresien des Socinus heraus, der sowohl die Gottheit Jesu wie den Gedanken der Stellvertretung ablehnte, und schildert ausführlich, mit welchen Argumenten Turrettini ihm widerstand; er verschweigt nicht, dass Turrettini der Auffassung war, dem Gläubigen werde die Gerechtigkeit Christi, die dieser sich durch das Halten der Gebote erworben habe, zugerechnet. Hinsichtlich Grotius diskutiert Craig, ob dieser eine bloße Regierungs- und Beispieltheorie – Gott kann als Souverän ohne Genugtuung Sünden vergeben, das Leiden Jesu dient lediglich als Beispiel – oder doch die Auffassung einer Strafstellvertretung vertreten habe. Er kommt zu dem Schluss, dass für Grotius Jesu Tod strafenden Charakter hatte, ihm der Gedanke der Zurechnung jedoch fremd war und Gott durchaus auch ohne Genugtuung hätte vergeben können, ohne dass seine Heiligkeit und Gerechtigkeit tangiert worden wären.
Auch am Ende des dritten Teils kommt Craig noch einmal auf Grotius zu sprechen. Nach dessen Auffassung geschah Jesu Strafleiden aus moralischen Gründen und war kontingent, also nicht notwendig.
Fazit
Die Verirrungen eines Grotius – Jesu Tod wird zum Strafexempel, mit dem Gott zeigt, wie sehr ihm Sünde missfällt – darzustellen, ist sehr verdienstvoll. Aufhorchen ließ mich zunächst die Passage, wo Craig zu einer Bewertung Grotius‘ kommt:
„Für Nachfolger des Hugo Grotius spielen solche Überlegungen hinsichtlich des Nutzens zwar eine wichtigere Rolle bei Gottes Entscheidung pro Strafstellvertretung als für Denker, die deren Notwendigkeit betonen. Doch auch für Theorien, die die Notwendigkeit einer Strafstellvertretung verfechten, sind solch negative Anreize – nicht länger im Zustand der Entfremdung zu bleiben – und positive Anreize – Gottes Versöhnungsangebot anzunehmen – durchaus relevant. Und natürlich ist auch bei Theorien, die die Notwendigkeit des Sühnungsopfers Jesu betonen, Gottes konkrete Wahl des Mittels, also seine Entscheidung für Christi Stellvertretertod, eine kontingente (sic!) Entscheidung. In der Wahl ausgerechnet dieses Mittels ist es gut möglich, dass Gott durch die positiven Auswirkungen der Passion Christi motiviert wurde.
Der moralische Einfluss, den der selbstaufopfernde Tod Christi auf die Menschheit ausübt, ist wahrhaftig von unschätzbarem Wert. … Seine Passion hat zahllose Menschen dazu inspiriert, mutig und glaubensvoll schreckliche Schmerzen und sogar den Tod zu ertragen. Wie bereits erwähnt, ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass nur in einer Welt, die solch einen Sühnetod beinhaltet, die optimale Anzahl von Menschen aus freien Stücken zu einer liebenden Gotteserkenntnis und ewigem Leben findet. Somit offenbart sich nicht nur Gottes Liebe und Heiligkeit, sondern auch seine Weisheit im stellvertretenden Sühnetod Christi.“
Die Übersetzung verleitete mich zu der Annahme, Craig habe ein ganzes Buch geschrieben, um die Plausibilität des stellvertretenden Opfers Jesu zu belegen und wie sehr diese dem innersten Wesen eines gerechten und liebenden Gottes entspricht, um dann zu erklären, dass Sühne zwar notwendig, die Wahl des Mittels – das Sühnopfer Jesu – jedoch „kontingent“, also nicht notwendig war. Dabei hätte Craig übersehen, dass manche Aspekte von Jesu Leben und Sterben sich durchaus als Vorbild für den Christen eignen, aber gerade nicht die sühnenden Leiden Jesu, die einzigartig und unnachahmlich sind. Er hätte ferner übersehen, dass Gottes Plan, den gefallenen Menschen vor der ewigen Verdammnis zu retten, durchaus kontingent war; Gott hätte uns wie den gefallenen Engel einen Weg zum Heil versagen können. Aber ein zur Rettung der Menschen entschlossener Gott hatte durchaus keine Wahl und musste das Liebste, was er hatte, seinen eingeborenen Sohn, auf diese Erde senden und den Menschen Jesus Christus in den drei Stunden der Finsternis verlassen!
Nach Rücksprache mit dem Übersetzer wurden meine Bedenken jedoch sämtlich zerstreut. Craig meint hier nämlich, wie mir Dr. Fabian Graßl versichert hat, nicht, dass Christi Stellvertretertod kontingent gewesen wäre, sondern lediglich die Wahl des Hinrichtungsmittels, also wie Jesus genau umgekommen ist. Das heißt, Jesus musste laut Craig sterben, da es Gottes Wesen, welches vollkommen gerecht ist, so erfordert; hier folgt Craig der Lehre von Anselm von Canterbury und modifiziert sie leicht. Aber w i e Jesus starb – ob durch Kreuz, Enthauptung, Geißelung oder ein sonstiges Hinrichtungsmittel –, ist kontingent. Diese Überzeugung ist natürlich völlig legitim und orthodox.
Kurzum: Craig führt auf 142 Seiten wunderbar konzise aus, was auch in folgendem Lied zum Ausdruck kommt:
Erkauft, erlöst, und nun Dein Eigen, /Herr Jesus, Dir gehören wir! / Wer konnte solche Liebe zeigen, / den Preis bezahlen – außer Dir?
Doch nicht vom Himmel aus geschehen / konnt das, was dafür nötig war. / Du musstest selbst zur Erde gehen, / dort war Dein Kreuz - war Golgatha!
Kein Wort der Macht von einem Schöpfer / reicht' aus zu unsrer Seligkeit. / Nur durch Dein Leiden, durch Dein Opfer / sind wir erlöst, sind wir befreit!
Frank Ulrich